Selbstbezichtigungen – und das leise Sichtbarwerden des Eigenen
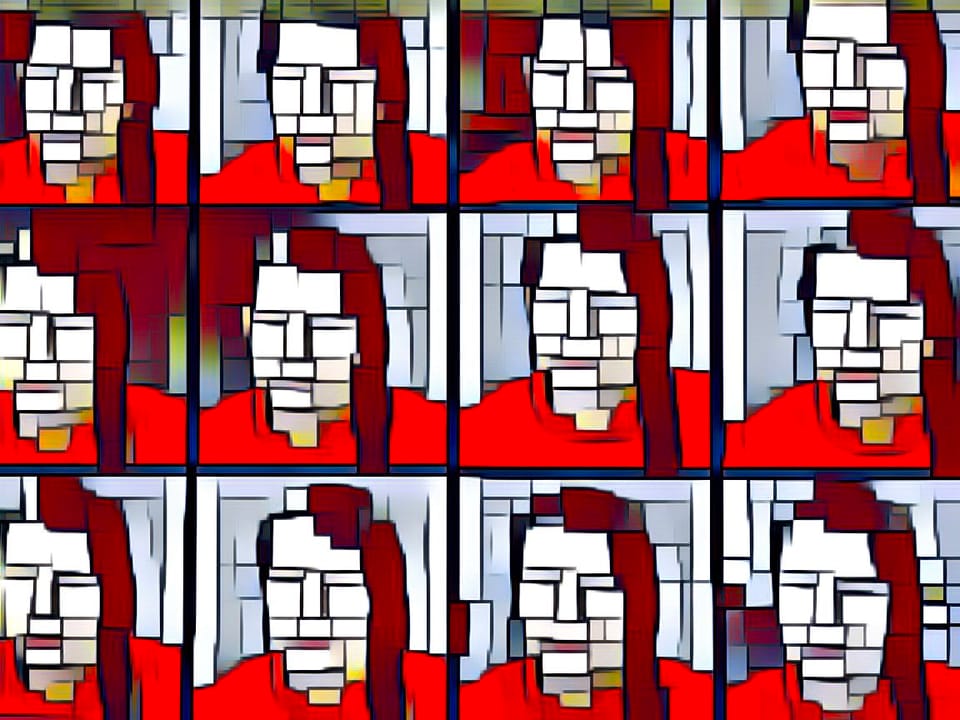
Es gibt Theaterabende, deren Wirkung sich nicht aus dem Plot, nicht aus der Figur und auch nicht aus der psychologischen Zeichnung speist, sondern aus dem Atem, der zwischen den Sätzen liegt. Abende, an denen das gesprochene Wort weniger Mitteilung als Verdichtung ist – ein sprachliches Kondensat, das sein eigenes Echo erst mit der Zeit preisgibt.
Peter Handkes Selbstbezichtigungen, in der jüngsten Interpretation von Stefanie Reinsberger, gehört in diese Kategorie. Kein Drama im klassischen Sinn, keine Handlung, die sich entwickelt. Vielmehr ein Sprachstrom, der das Ich umkreist, festhält, wieder freigibt und erneut bindet. Ein Text, der sich anhebt wie eine Litanei und zugleich immer wieder in sich selbst zusammenfällt.
Die Wiederaufnahme am Akademietheater vom 6.12.2025 zeigt dies deutlicher als frühere Fassungen: Reinsberger spielt den Text nicht – sie entfesselt ihn. Dialektwechsel, Tempi, ironische Brechungen, stimmliche Eskalationen. Ein Virtuosenfeuerwerk, das Handkes Text eher als Material nutzt denn als inneren Erkundungsraum. Der „Selbstbezichtigung“ wohnt hier weniger ein psychologisches Moment inne als eine performative Überfülle, die den Text überstrahlt.
Gerade diese Überfülle macht sichtbar, wie fremd ein solcher Monolog dem mediationsorientierten Verständnis von Selbstklärung ist.
Und doch – in dieser Distanz, in dieser Überzeichnung, in diesem Übermaß liegt ein Schlüssel:
Im Kontrast zu Reinsbergers kraftvoller Selbstexponierung lässt sich präziser fassen, was Selbstklärung im Sinne des A_MMM tatsächlich bedeutet.
Die Stimme, die sich selbst verfolgt – und der Raum, der sie trägt
Reinsberger verkörpert den Text nicht, sie trägt ihn.
Sie leiht ihm Atem, Körper, Rhythmus – ohne sich zu ihm zu bekennen. Dadurch entsteht ein bewegliches Verhältnis zwischen Sprecherin und Sprache. Es ist ein Verhältnis, das im Kontext mediationsorientierter Selbstklärung eine überraschende Resonanz erzeugt.
Denn Reinsberger zeigt, was geschieht, wenn Sprache zur Schleife wird.
Wenn das, was ausgesprochen wird, keine Beziehung mehr kennt – weder zum Gegenüber noch zum eigenen Inneren.
Die Sätze treiben voran, dann stocken sie. Sie beherrschen die Bühne und fliehen zugleich aus ihr heraus. Ein Ich, das sich einholt und sich gegen die eigene Stimme behaupten muss. Eine Selbstkonfrontation ohne Ausweichmöglichkeit.
In der jüngsten Inszenierung verstärkt sich diese Bewegung durch die ästhetische Überzeichnung: ein Prestissimo des Sprechens, ein Wechsel der Register, eine spürbare Lust an der stimmlichen Überwältigung. Es ist große Kunst – aber keine Selbstprüfung. Eine exponierte Präsenz, keine innere Bewegung.
Gerade diese Unentrinnbarkeit unterscheidet Handkes Text fundamental vom Raum einer Mediation.
Denn Mediation schafft – bewusst – Unterbrechbarkeit.
Sie schafft Zwischenräume, Atemzüge, Resonanzflächen. Orte, an denen Sprache sich setzen kann, ohne sich selbst zu verfolgen. Orte, an denen die eigene Stimme nicht Gefängnis ist, sondern Möglichkeit.
Die Differenz – und warum sie so wichtig ist
Parteiäußerungen in der Mediation ähneln Handkes Selbstbezichtigungen nicht.
Zu Beginn richten sich Sätze fast ausschließlich nach außen:
auf den Konfliktpartner, auf Zuschreibungen, auf Erwartungen, auf Verletzungen.
Das Ich ist kein Ort der Selbstprüfung, sondern ein Ort der Positionierung.
Erst später – manchmal widerwillig, manchmal überraschend früh – taucht ein Moment auf, in dem der Fokus sich verschiebt.
Ein Satz ändert seinen Klang.
Er wird leiser, tastender, weniger konfrontativ.
Ein Satz wie:
„Ich höre mich gerade selbst reden – und es klingt härter, als ich es fühle.“
„Vielleicht habe ich mich in etwas verrannt.“
„Ich merke, dass mich manches mehr trifft, als ich zugeben wollte.“
Diese Sätze haben nichts von der Monumentalität der Selbstbezichtigungen.
Und dennoch verbinden sie sich mit einem ihrer zentralen Motive:
der Frage, wie ein Mensch klingt, wenn er über sich spricht.
Denn in der Selbstklärung – im Feld c-me des Ad_Monter Meta Modells – geht es nicht um moralische Urteile über sich selbst.
Es geht darum, Töne zu hören.
Nicht das Was ist entscheidend, sondern das Wie.
Nicht der Inhalt, sondern die innere Bewegung, die im Sprechen sichtbar wird.
So entsteht die erste Verbindungslinie:
Der Mechanismus des Sprechens – nicht sein Pathos – ist die Brücke zwischen Bühne und Mediationsraum.
Selbstklärung als Resonanzarbeit – nicht als Selbstgericht
Selbstklärung im mediationsorientierten Verständnis ist das Gegenteil der performativen Selbstanklage.
Sie ist kein dramatisches Sich-Ausliefern, kein Bekenntnis, keine Buße.
Sie ist ein Resonanzvorgang, bei dem ein Mensch wahrnimmt, welche inneren Regungen ein eigener Satz auslöst.
Es ist oft ein kleiner Moment:
ein Nachspüren, ein kurzes Innehalten, eine unvorhergesehene Bewegung im Inneren.
Manchmal merkt eine Partei erst im Sprechen:
- dass ein Vorwurf eigentlich ein Schmerz ist,
- dass ein hartes Urteil eine Verunsicherung schützt,
- dass Erschöpfung unter dem Ärger verborgen liegt.
Selbstklärung ist weder heroisch noch spektakulär.
Sie ist eine Verschiebung –
von der Selbstbehauptung zur Selbstwahrnehmung.
Handke zeigt – in radikaler Übertreibung –, wie Selbstbezüglichkeit aussieht, wenn sie keine Beziehung hat. Wenn sie sich selbst verstärkt, ohne Gegenüber.
Der mediative Prozess hingegen verwandelt Selbstbezug in ein Beziehungsangebot:
Er macht das Innere anschlussfähig.
Der doppelte Resonanzraum – wenn eine Partei hört, wie die andere über sich spricht
Selbstklärung geschieht nicht im luftleeren Raum.
Sie gewinnt ihre Wirkung erst, wenn die Gegenpartei hört, was geschieht.
Nicht als Richterin, nicht als Diagnostikerin, sondern als Zeugin einer Innenbewegung.
Wenn eine Partei etwas über sich selbst sagt – leise, tastend –, verändert sich etwas im Raum:
Die Gegenpartei hört einen Ton, der nicht gegen sie gerichtet ist.
Das Bild des Anderen wird porös.
Die Härte tritt zurück.
Die Möglichkeit der Beziehung tritt hervor.
Das ist keine Sentimentalität –
es ist eine Systemverschiebung.
Das A_MMM beschreibt diesen Übergang als Öffnung von c-me zu c-us:
Selbstkontakt wird zu Beziehungskontakt.
Position wird Person.
Konflikt wird Resonanz.
Auf der Bühne bleibt Handkes Ich allein mit sich selbst.
Im Mediationsraum entsteht Bezug.
Die Kunst des Innehaltens – und die Rolle der Mediatorin
Selbstklärung ist eine Innenbewegung, die durch äußere Struktur möglich wird.
Die Mediatorin hält einen Raum, in dem die Partei nicht psychologisiert, nicht dramatisiert, nicht vorschnell interpretiert wird.
Stattdessen entsteht Verlangsamung.
Zwischenräume.
Differenzierung.
Ein einfacher Satz wie:
„Ich weiß nicht, warum mich das so getroffen hat“
kann – gehalten im richtigen Moment – mehr bewirken als eine lange Argumentation.
Im A_MMM entsteht Selbstklärung aus Freiheit:
aus der Möglichkeit, sich selbst anders zu hören,
nicht aus dem Druck, sich selbst richten zu müssen.
Sprache als Übergang – nicht als Urteil
Handkes Monolog ist eine geschlossene Figur.
Er kennt keine dialogische Öffnung, keine Wendung, keinen Übergang.
Er ist, ästhetisch betrachtet, eine Selbstzuschreibung ohne Beziehung.
Gerade deshalb eignet er sich als Kontrastfolie.
Denn in der Mediation wird Sprache zum Übergang:
- vom inneren Erleben zur äußeren Beziehung,
- vom fixierten Narrativ zur beweglicheren Selbstsicht,
- von c-me zu c-us.
Dieser Übergang ist das eigentliche Herz mediationsorientierter Arbeit.
Was Handke uns lehrt – indirekt, aber präzise
Selbstbezichtigungen ist kein Lehrstück über Konflikt.
Es ist ein Spiegel für die Frage:
Wie klingt ein Mensch, der allein bleibt in seinen Sätzen?
Mediation beantwortet diese Frage nicht mit Pathos,
sondern mit Struktur.
Selbstklärung bedeutet nicht, sich selbst zu verurteilen.
Sie bedeutet, sich selbst zu hören –
und dem anderen zu erlauben, mitzuhören,
damit Beziehung wieder möglich wird.
Handke zeigt das Echo in einem geschlossenen Raum.
Mediation öffnet die Tür.
Das leise Bild des Übergangs
Wenn Stefanie Reinsberger Handkes Text spricht, entsteht ein Raum voller Intensität – ein Raum, in dem das Ich sich selbst verfolgt.
Gerade dadurch wird sichtbar, wie wertvoll jene kleinen, unspektakulären Sätze sind, die in einer Mediation auftauchen:
Momente, in denen ein Mensch etwas sagt, das nicht mehr gegen den anderen gerichtet ist, sondern als innerer Kontakt spürbar wird.
Kein Bekenntnis.
Kein Schuldeingeständnis.
Ein Übergang.
Selbstklärung ist nicht die große Selbstanklage,
sondern das kleine Innehalten,
das hörbar macht, dass ein Mensch wandelbar ist.
Und Wandel beginnt stets dort,
wo ein Satz weicher wird
und ein anderer beginnt zu hören.
